
Jonas Betzendahl ist Doktorand an der Universität Erlangen und seit sechs Jahren als Science Slammer aktiv. In diesem Interview berichtet er, wie er mit Science Slam neues Publikum für Wissenschaftsthemen erreicht. Hier auf Science to go findet ihr einen Science Slam-Mitschnitt. Mehr gibt es unter scienceslam.de.
Im Gespräch mit einem Science Slammer
Worum geht es bei einem Science Slam?
Beim Science Slam präsentieren Wissenschaftler*:innen einem breiten Publikum ein Thema aus ihrer eigenen Forschung in einem möglichst unterhaltsamen Vortrag. Das Format ist besonders im deutschsprachigen Raum beliebt und ist in meinen Augen ein Stück Kultur, jedenfalls viel mehr als reine Unterhaltung.
Wie bist du zum Slammer geworden?
Einer meiner Dozenten hat mich zu einem Slam mitgenommen, bei dem er aufgetreten ist. Das hat mich so fasziniert, dass ich es unbedingt selbst ausprobieren wollte. Beim FameLab in Hannover habe ich dann 2016 meinen ersten Slam gemacht, zum Thema „Automatisierte Beweisführung: Wie man einen Mathematiker abschafft“. Seitdem bin ich mit dem Slammer-Virus infiziert.
Wie kommst du an deine Themen?
Ich bin nicht nur ein Wissenschaftler, sondern auch ein politischer Mensch. Die Themen für meine Slams finde ich dort, wo beide Sphären zusammenkommen. Als Informatiker interessiert mich z. B. das maschinelle Lernen, das gleichzeitig viele gesellschaftliche Fragen aufwirft, weil es Entscheidungen vom Menschen zur Maschine verlagert.
Welche Rolle spielt der Humor bei deinen Auftritten?
Humor ist eine gute Möglichkeit, um sein Publikum zu unterhalten, aber ich kenne auch sehr gute Slams, die das über ein Gedicht oder einen Zaubertrick schaffen. Man sollte immer eine Balance finden zum wissenschaftlichen Inhalt, damit ein Science Slam nicht zur Gag-Show mutiert.
Hattest du schon mal Lampenfieber?
Das habe ich vor jedem Auftritt, aber wenn ich dann mit dem Vortrag beginne, ist es zum Glück rasch verflogen. Ich probe meinen Vortrag auch nicht im Vorhinein, sondern versuche ganz spontan zu sein.
Wie wichtig ist das Publikum?
Sehr wichtig. Ich sehe an der Reaktion des Publikums, ob ich mit meinem Vortrag rüberkomme und beziehe es auch gerne mal mit ein. Noch bevor der Moderator das Abstimmungsergebnis bekannt gibt, weiß ich in der Regel, ob ich gut angekommen bin oder nicht. Ich musste aber lernen, dass es große regionale Unterschiede gibt. Ein Publikum in Flensburg reagiert ganz anders auf meinen Vortrag als eines in Leipzig oder in München.
Würdest du anderen jungen Wissenschaftler*innen empfehlen, beim Science Slam mitzumachen?
Unbedingt! Es macht wahnsinnig viel Spaß und man kann damit ein ganz anderes Publikum erreichen als mit „normaler“ Wissenschaftskommunikation.
Interesse an mehr?

Warum ist der Himmel blau? Experimente mit Streulicht
Wenn wir draußen nach oben schauen, blicken wir durch die Atmosphäre unserer Erde. Die besteht hauptsächlich aus Stickstoff und Sauerstoff – zwei Gasen, die eigentlich farblos, das heißt durchsichtig sind. Das zeigt sich uns nachts, denn dann sehen wir die Atmosphäre...

Griff nach den Sternen: Die Backpulver-Rakete hebt ab
Die sprichwörtliche “Raketenwissenschaft” ist im Grunde recht simpel. Eine Rakete ist schließlich nichts weiter als eine Röhre mit einer Düse am unteren Ende, durch die ein Treibgas ausströmt und die Rakete so beschleunigt. Mit ein paar haushaltsüblichen Zutaten könnt...
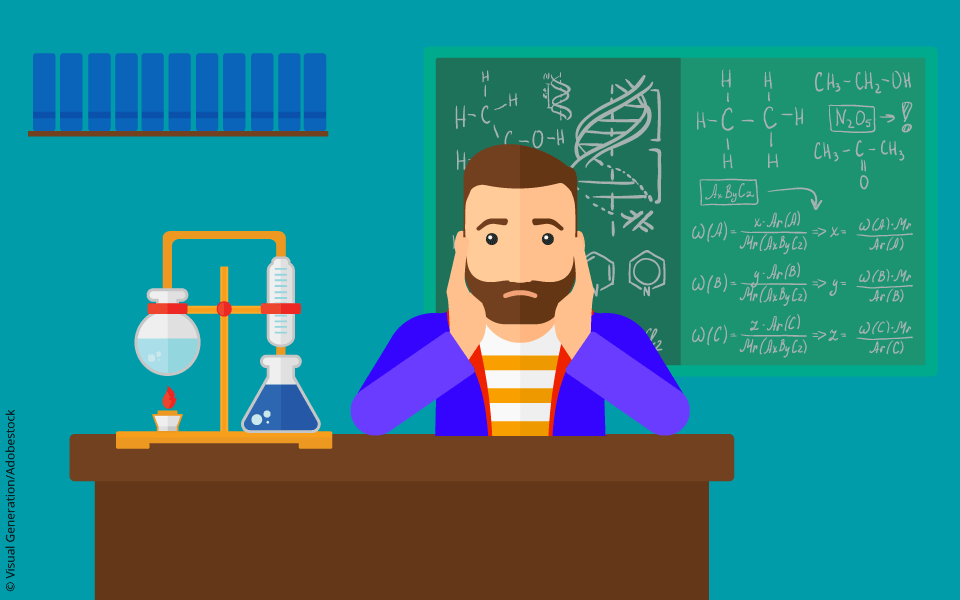
Paradoxe Notenspiegel
Chemielehrer Hans Weindorf ist verzweifelt. Er unterrichtet zwei 8. Klassen in Chemie, in denen er am selben Tag dieselbe Klassenarbeit hat schreiben lassen. In Klasse 8a mit 25 Schüler*innen ist sie mit einer Durchschnittsnote von 3,04 ganz ordentlich ausgefallen, in...
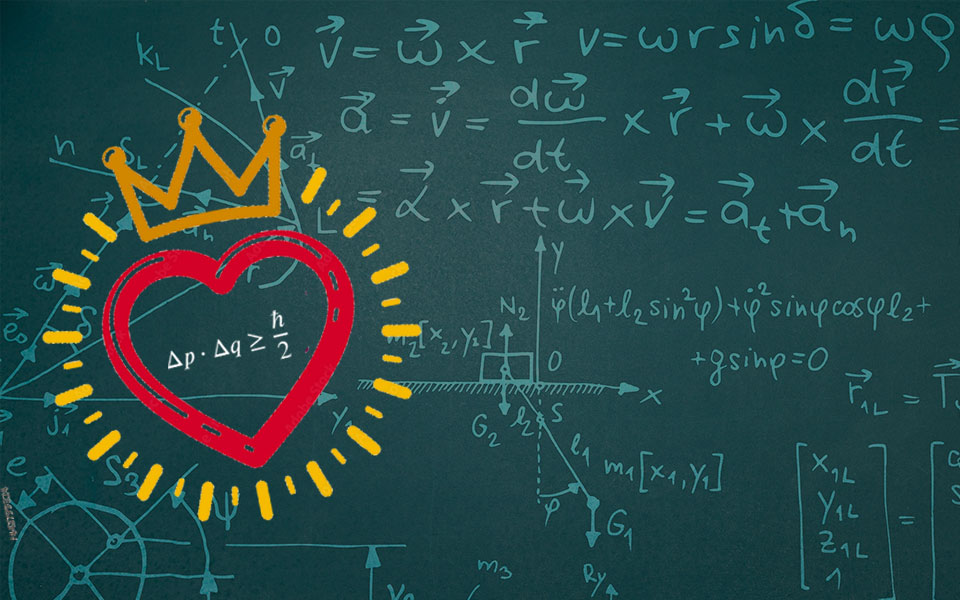
Mathematik: Man kann ihr nicht entkommen
Dem Mathematiker Carl Friedrich Gauss wird die Aussage zugeschrieben: „Die Mathematik ist die Königin der Wissenschaften.“ Genauso gut könnte man diese Aussage umdrehen: „Die Mathematik ist die Dienerin der Wissenschaften“, denn in allen Natur-, Ingenieur- und...
