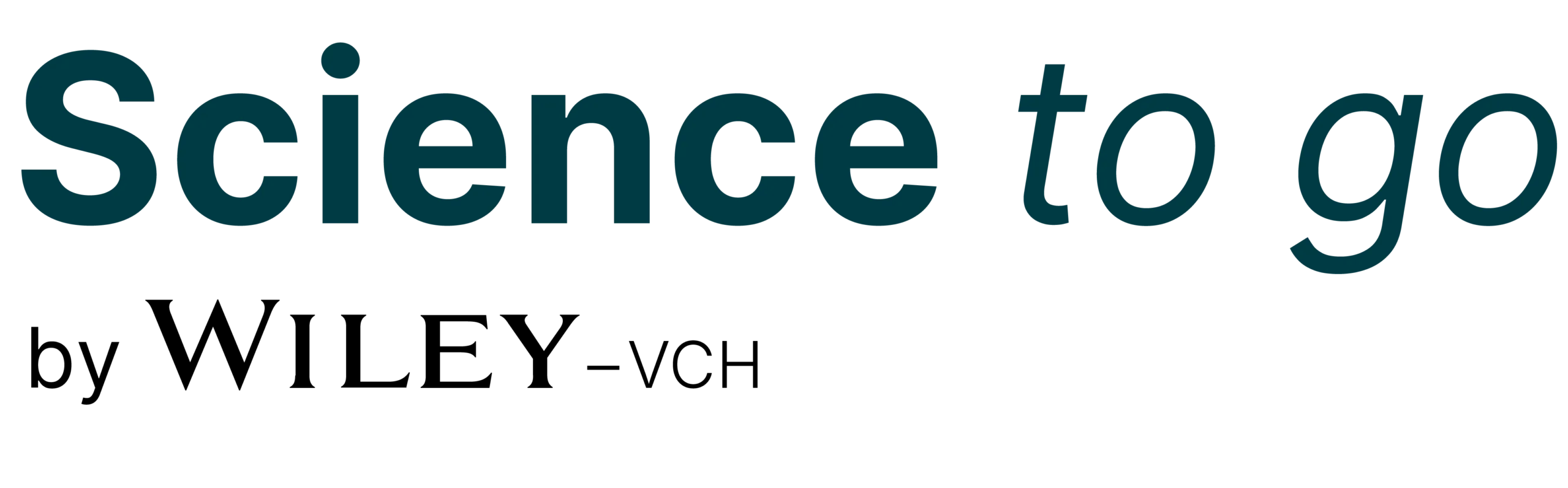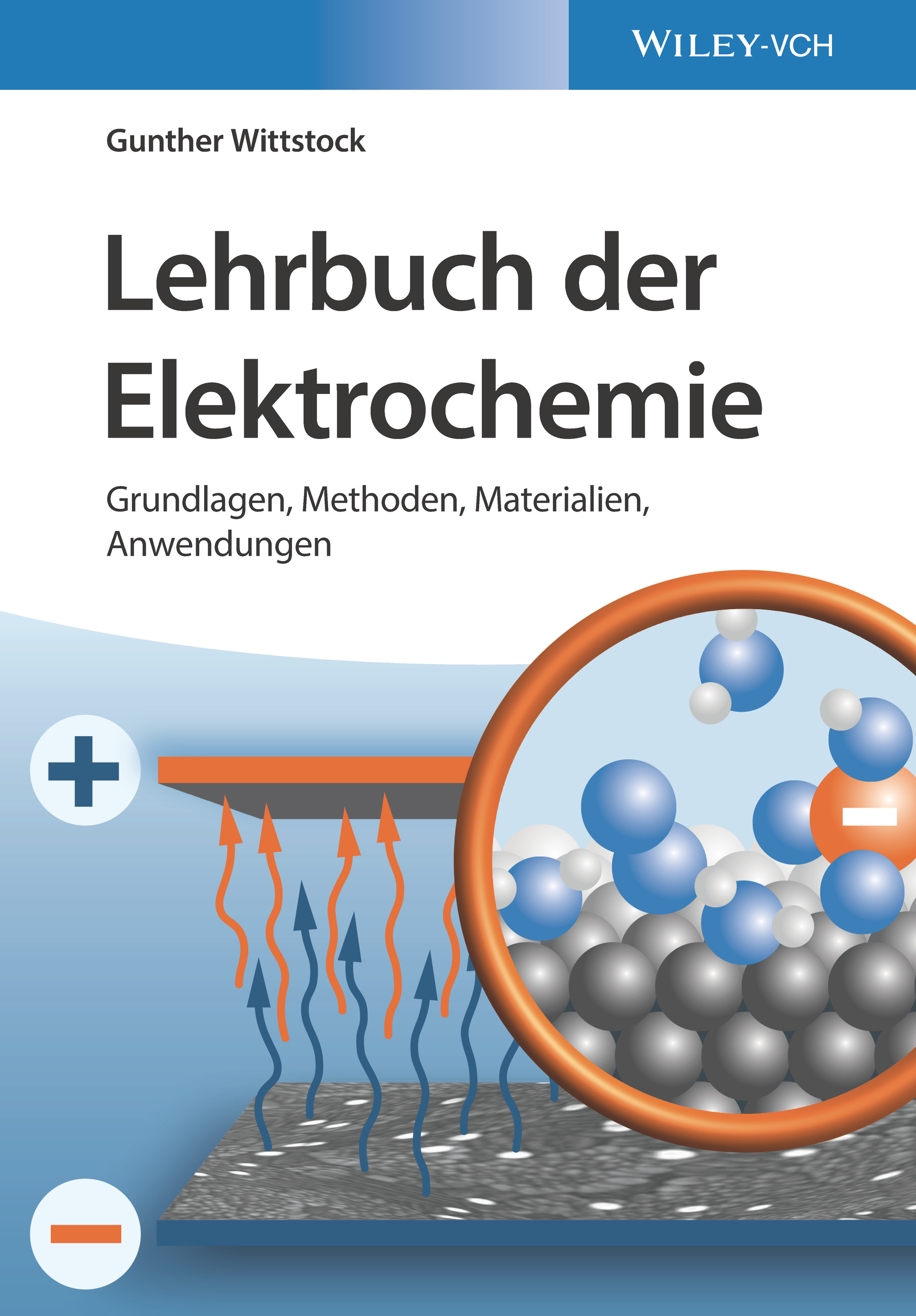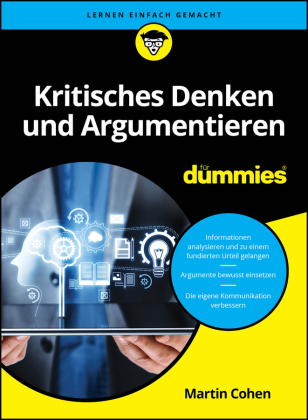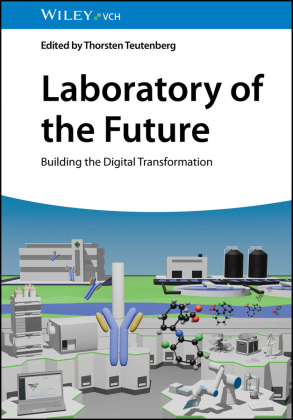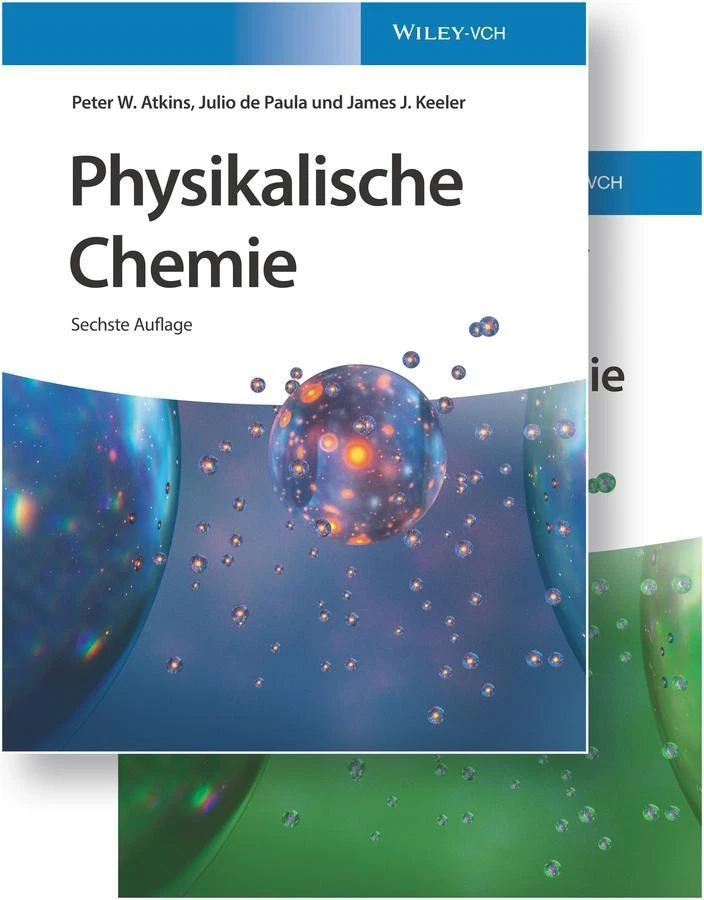Okay, geschafft: Mein Vortrag ist vorbei. Ich habe über meine Forschung zu molekularen Sensoren gesprochen. Die Folien haben funktioniert, das Publikum war aufmerksam. Jetzt kommt der Teil, den ich nie ganz kontrollieren kann: die Fragerunde. Wir spielen ein paar typische Situationen durch, damit ihr gut vorbereitet seid.
Moderator: Vielen Dank für den spannenden Vortrag. Gibt es Fragen?
Das Spannende an dieser Situation ist ja: Man weiß nie, welche Fragen kommen. Also versucht am besten, gleichzeitig locker und konzentriert zu sein. Bleibt ruhig, freundlich und antwortet nicht zu spontan – denkt einen Moment nach, bevor ihr sprecht. Nach unserer Erfahrung sind folgende Fragetypen am häufigsten vertreten:
Frage 1: Der Interessierte
„Könnten Sie noch einmal erklären, wie die Selektivität Ihrer Sensoren funktioniert?“
Sehr schön, das ist eine gute Frage zu einem wichtigen Punkt! Ich erkläre den Zusammenhang nochmal – aber schön kompakt, also ohne etwa zu tief in die Chemie abzutauchen. Etwa so
Antwort: „Gerne! Die Selektivität ergibt sich aus der spezifischen Wechselwirkung zwischen dem Sensor und dem Zielmolekül – wir nutzen dabei strukturelle Komplementarität und elektronische Eigenschaften.“
Frage 2: Der Kritiker
„Ich finde, Ihre Daten sind nicht eindeutig. Haben Sie die Kontrollversuche mit anderen Substanzen gemacht?“
Okay, das ist kritisch, aber eine sachlich berechtigte Frage. Hier heißt es jetzt: Nicht defensiv werden! Ich habe die Kontrollen gemacht – ich muss das nur ruhig und sachlich vermitteln.
Antwort: „Ja, wir haben Vergleichsmessungen mit strukturell ähnlichen Molekülen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im Supplement dargestellt – ich kann Ihnen das gern zeigen.“
Frage 3: Der Selbstdarsteller
„Ich habe selbst zu Sensorik gearbeitet. In meiner Dissertation habe ich ein ähnliches System entwickelt, das…“
Oh, das ist kein echtes Interesse, sondern der Beginn eines Monologs. Ich nicke, lächle und versuche, das Gespräch höflich zu beenden.
Antwort: „Das klingt spannend. Vielleicht können wir uns nach der Veranstaltung darüber austauschen – ich würde Ihre Arbeit gern kennenlernen.“
Frage 4: Der Verwirrte
„Also … ist das jetzt ein chemischer oder ein physikalischer Sensor? Ich bin da nicht ganz mitgekommen.“
Kein Problem. Das ist eine Gelegenheit, den Sachverhalt nochmal klar zu formulieren. Ich muss nur darauf achten, niemanden bloßstellen.
Antwort: „Das ist eine gute Frage. Unser Sensor basiert auf chemischen Wechselwirkungen, aber die Auswertung erfolgt physikalisch – über elektrische Signale.“
Frage 5: Der Provokateur
„Glauben Sie wirklich, dass Ihre Forschung jemals praktisch relevant wird?“
Oha. Das ist provokant. Ich bleibe ruhig. Ich glaube an meine Arbeit – und das sage ich auch.
Antwort: „Ich denke, Grundlagenforschung ist ein wichtiger Schritt. Anwendungen entstehen oft Jahre später – aber ohne diese Basis wären viele zentrale Technologien heute nicht denkbar.“
Puh. Geschafft. Ich habe alle Fragen beantwortet, niemanden bloßgestellt, und meine Arbeit verteidigt. Vielleicht war das sogar der wichtigste Teil des Vortrags!