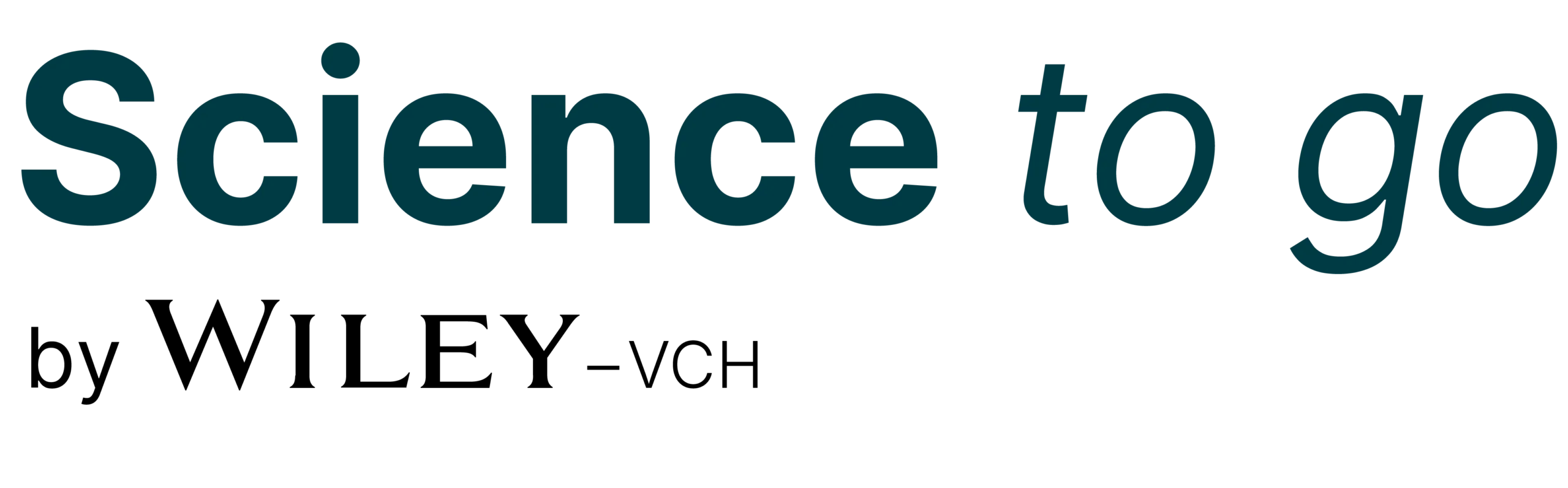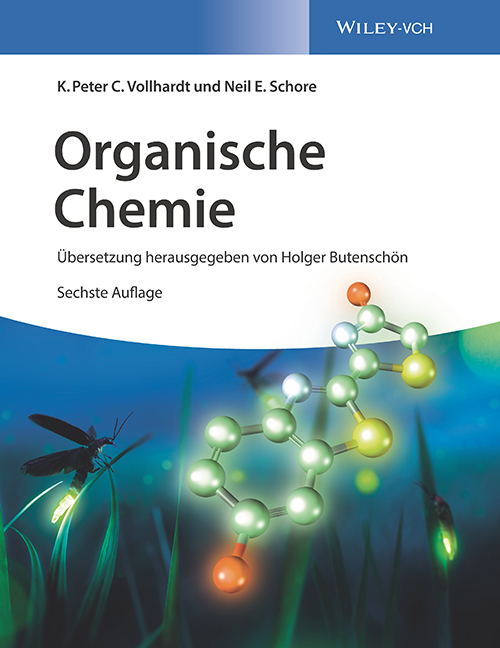Stell dir vor, du baust mit LEGO – aber nicht irgendeine Form, sondern eine Kette aus sage und schreibe 1172 winzigen Bausteinen, die alle exakt gleich aussehen. Willkommen in der Welt der Alkane! Alkane sind Stoffe, die nur aus Kohlen- und Wasserstoffatomen bestehen. Sie folgen der Summenformel: CnH2n+2.
Und C₃₉₀H₇₈₂ – der längste künstlich hergestellte lineare Kohlenwasserstoff – ist genau das: eine molekulare Perlenkette aus 390 Kohlenstoff- und 782 Wasserstoffatomen. Und ja, das ist ein echtes Molekül – keine Sciencefiction! Aber warum macht man sich überhaupt die Mühe, ein solches Monstermolekül zu bauen?
Kohlenwasserstoffe: die unterschätzten Helden des Alltags
Kohlenwasserstoffe sind die Grundbausteine der organischen Chemie. Sie stecken in Benzin, Plastik und Kerzenwachs – und auch in deinem Lieblingsshampoo. Ohne sie gäbe es keine Kunststoffe, keine Pharmazeutika, keine Farben, keine Kosmetika. Sie sind so allgegenwärtig, dass man sich praktisch nie bewusst macht, wie wichtig sie für unser tägliches Leben sind.
Die einfachsten Vertreter ihrer Art – Methan, Ethan, Propan – sind gasförmig. Mit zunehmender Kettenlänge werden sie zunächst flüssig, dann wachsartig und schließlich fest. Und irgendwann landet man bei Molekülen wie eben dem C₃₉₀H₇₈₂, das bei 132 °C schmilzt und sich dabei wie ein nervöser Tausendfüßler auffaltet – ein Effekt, der auf sogenannte London-Kräfte zurückgeht, also schwache Anziehungskräfte zwischen den Molekülteilen.
Wie entsteht so ein Molekül?
Die Synthese solcher Giganten ist ein Geduldsspiel. Man arbeitet sich Schritt für Schritt voran, oft mit Schutzgruppen und Katalysatoren, um unerwünschte Nebenreaktionen zu vermeiden. Es ist ein bisschen wie das Aufstellen von Dominosteinen – nur dass hier wirklich jeder „Stein“ exakt „stehen“ muss, sonst fällt alles in sich zusammen.
Ein berühmter Chemiker sagte einmal: „Organische Synthese ist wie Schach – nur dass man die Figuren selbst bauen muss.“ Und genau das passiert hier: Die Forscher*innen bauen sich ihre Moleküle Atom für Atom zusammen, um am Ende ein Modell zu erhalten, das z. B. die Eigenschaften von Polyethylen simuliert – dem Kunststoff, aus dem Tüten, Folien und zahllose Alltagsgegenstände bestehen.
Anekdote aus dem Labor
Ein Doktorand, der an einem ähnlichen Projekt arbeitete, erzählte einmal, dass er sein Molekül liebevoll „Fred“ nannte – weil es so störrisch war. „Fred“ wollte einfach nicht kristallisieren, bis „er“ eines Tages – nach Wochen des Wartens – plötzlich perfekte Kristalle bildete. Der Jubel im Labor war groß, und Fred bekam einen Ehrenplatz im Kühlschrank.
Warum das Ganze?
Solche Moleküle sind nicht nur akademische Spielereien. Sie helfen, die Eigenschaften von Polymeren besser zu verstehen, etwa wie sich lange Ketten falten, wie sie mit Licht oder Wärme reagieren oder wie sie sich in verschiedenen Lösungsmitteln verhalten. Das ist wichtig für die Entwicklung neuer Materialien – von flexiblen Displays bis hin zu biokompatiblen Implantaten.
Und ganz nebenbei zeigen sie auch: Chemie kann wunderschön sein! Selbst wenn man sie nur unter dem Rasterelektronenmikroskop bewundern kann.
Mehr über die Struktur und Bindung organischer Moleküle erfährst du hier im ausführlichen Probekapitel aus „Organische Chemie“ von Vollhardt/Schore (pdf).
Aus: Vollhardt/Schore, Organische Chemie, 6. Auflage, August 2020, 9783527345823